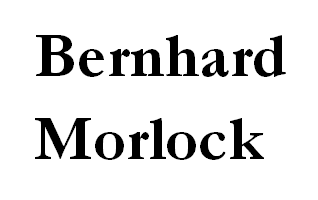Kapitel eins
Ellen von Eschring hatte die zierliche Gestalt ihrer Mutter, auch wenn ihre Schultern durch den Schwimmsport stärker geformt waren. Sie besaß die gleiche Eleganz, die man nicht ausbilden kann. Die in die Wiege gelegt sein muss.
Ellens Ausstrahlung gab anderen Menschen unwillkürlich Respekt auf. Bei der Arbeit als Anwältin der Frankfurter Oberschicht war ihr dies von Vorteil.
Mit 13 hatte Ellen ihrer Mutter verblüffend ähnlich gesehen. Doch bestand diese Ähnlichkeit nicht lange. 1981 wurde zu einem Unglücksjahr. Ellens Mutter hatte eine Fehlgeburt. Danach wurde sie immer schwächer, als hätte sie eine Wunde erlitten, aus der ihre Kraft unaufhaltsam entwich. Eine Wunde, die nicht mehr verheilte.
In der 21. Woche ihrer Schwangerschaft hatte Mama plötzlich Blutungen. Ellens Bruder starb in Mamas Bauch. Sein Herz hörte auf zu schlagen. In einem Krankenwagen, der auf dem Grüneburgweg im Stau festhing. Die Ärzte versuchten, ihn mit einem Kaiserschnitt zu retten. Doch es war zu spät.
Der kleine Leib wog keine 400 Gramm. Nach dem Gesetz durfte ein tot geborenes Kind mit einem so geringen Gewicht nicht auf dem Friedhof beerdigt werden. Das Gesetz sah dieses Kind nicht als Menschen, sondern als etwas, das durch das Krankenhaus zu entsorgen war.
Ellen wollte nicht hinnehmen, dass ihr Bruder auf diese Weise ging. Sie kämpfte für ihn. Sie stritt im Krankenhaus mit jedem, den sie zu fassen bekam. Den Schwestern. Den Ärzten. Den Bürokräften. Und sie stritt mit ihrem Vater. Bis er sich bereitfand, seine Verbindungen zu nutzen, um eine Ausnahme zu erreichen.
Sie gaben dem Jungen den Namen Lukas. Bei den Familienbildern auf der Anrichte im Esszimmer stand eine Ultraschall-Aufnahme, die ihn im Mutterleib zeigte. Die Aufnahme war bei einer Untersuchung wenige Tage vor dem Unglück entstanden. Sie war schwarz-weiß und etwas unscharf. Trotzdem war Lukas gut zu erkennen.
Ellens Mutter musste eine Woche im Krankenhaus bleiben. Oft lag Ellen bei ihr. Und weinte mit ihr. Hilflos sah sie mit an, wie ihre Mutter sich veränderte. Wie sie verfiel.
Diese Zeit trug Ellen seither in sich wie einen schwarzen Stein: Schwer und dunkel und furchtbar.
Sie erinnerte sich sofort daran, als ihre Mutter drei Jahre später einen Schlaganfall erlitt. Am Morgen nach der Aufführung von Beckers letztem Theater-Projekt. Romeo und Julia. Sebastian und Ellen.
Mama brach zusammen, während sie das Frühstück richtete. Von einem Moment auf den anderen wurde sie bewusstlos. Bei dem Sturz schlug sie mit dem Kopf unglücklich auf die Küchenfliesen, sodass sie sich noch eine schlimme Platzwunde zuzog. Die Wunde wurde genäht und dafür ein Teil ihres Haares wegrasiert.
Ellen wich nicht von ihrer Seite. Sie fuhr mit ihr im Krankenwagen. Im Krankenhaus blieb sie an ihrem Bett. Die ganze Zeit erlangte ihre Mutter das Bewusstsein nicht zurück. Und die Ärzte entschieden, sie erst aufzuwecken, wenn sie ihre Untersuchungen abgeschlossen hatten.
An diesem Tag ging Ellen nicht zur Schule. So erfuhr sie erst nachmittags, was dort geschehen war, während sie bei ihrer Mutter gewacht hatte. Sie erfuhr es von ihrem Vater, der sich zwischen Terminen bei Gericht und in der Kanzlei, zwischen zu Hause und dem Krankenhaus hin- und herbewegte.
Ellens Freundin Dorothea hatte versucht, sich das Leben zu nehmen. Schuldirektor Ehrenfeldt hatte Ellens Vater angerufen und ihm berichtet, was sie getan hatte. Warum sie es getan hatte. Dass es wegen Sebastian war. In der Schule hatte es deswegen einen Aufruhr gegeben. Sebastian war dann zu Ellen nach Hause gekommen, um sie zu sehen. Ihr Vater hatte ihn zum Teufel gejagt.
Ellen hörte die Worte ihres Vaters wie aus weiter Ferne. Unwirklich. Sie schien in eine Art Dämmerzustand gefallen. In einen bösen Traum. Doch aus diesem Traum gab es kein Erwachen. Sie musste begreifen, dass ihr Leben sich plötzlich in einem Sturm fand, der alles niederriss.
Ellen saß den ganzen Tag am Bett ihrer Mutter und hielt eine kraftlose Hand. Ringsum arbeiteten Maschinen. Die Kabel wirkten, als ergriffen sie Besitz von dem Körper.
Mama wurde künstlich beatmet. Das Bild der schiefen Lippen, durch die der Atemschlauch drang, sollte Ellen nie mehr verlassen.
Mama sah aus, als schlafe sie. Ihre Augen waren geschlossen. Doch es war kein Schlaf. Sie hatte sich bereits verabschiedet.
Abends zu Hause erfasste Ellen eine eigenartige Unruhe. Sie wollte noch einmal ins Krankenhaus.
Ihr Vater erklärte ihr, dass es bei dem Zustand ihrer Mutter keinen Sinn hatte. Und Ellen ließ sich darauf ein. Vielleicht auch deshalb, weil es ihr graute, damit wieder jenen alten schwarzen Stein hervor zu heben.
In dieser Nacht starb Mama. An einem Septembermorgen wurde sie in dem Familiengrab der von Eschrings neben dem kleinen Lukas beigesetzt. Das war vor zwölf Jahren.
Ellen war nun 29. Sie wohnte noch mit ihrem Vater am Westende des Grüneburgwegs. Sie hatte ihre Zimmer im zweiten Stock. Ihr Vater bewohnte das Mittelgeschoss. Die Räume im Parterre nutzten sie gemeinsam.
Das Haus gehörte der Familie schon über Generationen. Erbaut war es Mitte des 18. Jahrhunderts auf einem Grundstück, das die von Eschrings von der befreundeten Familie von Goethe erworben hatten. Es war ein Schmuckstück des Stadtviertels und stand unter Denkmalschutz.
Ellen saß auf der Polsterbank am Fußende ihres Betts. Ringsum verteilten sich Kartons. Vieles war schon für den Umzug nach London verpackt.
Die Schränke in der Ankleide nebenan standen offen. Ellen hatte damit begonnen, Kleidung auszusortieren, die sie in die Sammlung geben wollte. Anna half ihr, auch wenn es sie zu Tränen rührte.
Anna war schon lange die Haushälterin der von Eschrings. Sie hatte Ellen von Geburt an aufwachsen sehen. Seit sie wusste, dass Ellen auszog, sagte sie, dass sie sich zur Ruhe setze. Als hätte sie nun ihre Aufgabe erfüllt.
Ellen hatte nie etwas auf Schönheitsideale gegeben. Seit der Schulzeit war ein schwarzer Lidstrich das Einzige, was sie für ihre Erscheinung aufwendete.
Ihr blondes Haar war kürzer als damals. Auch war es von ein paar frühen grauen Strähnen durchzogen. Trotzdem dachte sie nicht daran, es zu färben.
Sie hatte es am Ansatz mit einem Tuch gebunden, wie sie es früher oft getan hatte. Das Tuch zeigte das Spektrum eines Regenbogens und hob sich damit deutlich von ihrer Kleidung ab. Pullover, Rock, Leggings: Ellen trug Schwarz.
Es war ein besonderes Tuch. In der Neun hatte sie es selbst bemalt.
Nun war es ihr Beitrag zu Maggies Achtziger-Feier. Ebenso der BW-Parka, der auf ihren Knien lag.
Sie hatte beides auf Demos getragen. Und auf den Kundgebungen der Grünen. Als die Grünen für sie noch eine Botschaft hatten.
Den BW-Parka hatte Ellen damals von ihrem Taschengeld in einem Second-Hand-Laden gekauft. Sie hatte mit Edding das Friedenszeichen auf den Rücken gemalt. Übergroß. Und unter die Flagge auf dem rechten Ärmel Munchs „Schrei“. Auf den linken Ärmel hatte sie einen Flicken mit der Friedenstaube genäht, weiß auf blauem Grund. Zwei weitere Aufnäher auf die Brust: Links die Europa-Sterne und rechts den Schriftzug „Schwerter zu Pflugscharen“ mit dem Muskelmann, der ein Schwert in einen Pflug umschmiedet. Am Ansatz der Kapuze pinnten einige Buttons mit dem Frauen-Symbol.
Den „Schwerter“-Aufnäher hatte sie von einer Klassenfahrt in die DDR mitgebracht. Sie hatte ihn in Dresden mit einem Punk gegen einen „Europa“-Aufnäher getauscht. Er löste sich an einer Seite.
Der Parka sei mehr Meinungsäußerung als Jacke, hatte Sebastian immer gesagt.
Ellen war gegen Aufrüstung und Atomkraft und Umweltverschmutzung auf der Straße gewesen, gegen Hunger und gegen die Diskriminierung von Ausländern und Homosexuellen.
Damals waren Sebastian und Dorothea und Lindner dabei. Einige Male auch Maggie, obwohl sie eigentlich zu ängstlich dafür war.
Seit ihrem ersten Tag am Goethe-Gymnasium waren sie in derselben Klasse. Außer Sebastian: Er war erst in der Sieben dazugekommen. Er hatte die Schule wechseln müssen, nachdem seine Mutter eine Lehrerin geschlagen hatte.
Becker hatte sie alle angetrieben. Er hatte an der Goethe Geschichte unterrichtet.
Becker war immer politisch gewesen, auch wenn er sich als Lehrer zurückhalten sollte. Von seinen Schülerinnen und Schülern hatte er erwartet, dass sie sich zu aktuellen Fragen eine Meinung bildeten und ihre Meinung offen vertraten. Sein Spruch war: Wer sich nicht zu Wort meldet, ist selbst schuld an seiner Regierung.
Becker hatte sie alle im Herbst 1983 nach Mutlangen zu einer Demo gegen das Wettrüsten gefahren. Ellens Vater hatte ihm deswegen Ärger gemacht. Er hatte sich bei Direktor Ehrenfeldt beschwert, und Ehrenfeldt hatte Becker einen Verweis erteilt. Von Eschring und Ehrenfeldt waren Schulfreunde.
Das Tuch und der BW-Parka hatten all die Jahre in einem Winkel des Kleiderschranks gelegen. Als Ellen nach Dorotheas Selbstmordversuch von der Goethe abging, um ihr Abitur im Internat in Speyer zu machen, hatte sie nichts mitgenommen, was sie an die Vergangenheit erinnerte.
Maggies Einladung brachte sie sofort darauf.
Nun hatte sie das Gefühl, dass sie mit den beiden Gegenständen die letzte Verbindung zu ihrem alten Ich in den Händen hielt. Und ihr war der Gedanke gekommen, dass sie beides nur für diesen Tag aufbewahrt haben könnte. Als Prüfstein für die Entscheidung, die sie zu treffen hatte. Ihre Vernunft arbeitete dagegen. Aber der Gedanke blieb.
In den zurückliegenden Wochen war ein Schatten auf das Leben gefallen, das Ellen führte.
Da war der Aktenordner mit alten Unterlagen ihres Vaters. Frau Klemmer, Büroleiterin in Vaters Anwaltskanzlei, hatte ihn ihr übergeben, weil sie nicht wusste, was damit nach so vielen Jahren geschehen sollte. Ellen hatte den Ordner durchgesehen. Dabei hatte sie herausgefunden, dass ihr Vater nicht ehrlich war, als er ihr riet, alles hinter sich zu lassen und nach Speyer zu wechseln.
Da war ihr Gespräch mit Becker. Ja: Sie hatte Becker besucht, um ihm Fragen zu stellen. Fragen zu damals. Becker hatte ihre Fragen nicht beantwortet. Ellen hatte gespürt, dass er mehr wusste, dass es etwas gab, das er zu sagen hatte. Aber er schien ihr nicht zu vertrauen.
Und natürlich war da Dorotheas Brief.
Dorothea schrieb, dass sie auf dem Klassentreffen zu Ende bringen werde, was ihr damals nicht gelungen sei. Sie war in der Schwimmhalle der Schule vom Drei-Meter-Brett in ein leeres Becken gesprungen. Sie hatte überlebt. Aber sie hatte ihre Beine verloren. Dass die Vergangenheit offenbar immer noch in Dorothea wühlte, ging Ellen trotz allem nah.
Dorothea schrieb auch von einem weiteren Brief, den sie Ellen vor mehr als zehn Jahren geschickt habe. Eine Erklärung. Eine Entschuldigung. Ein Brief, den Ellen nicht erhalten hatte.
Vielleicht gab es diesen Brief gar nicht? Doch welchen Grund konnte Dorothea haben zu lügen? Oder konnte es ein Zufall sein? Dinge gehen verloren.
Ellen hatte viel nachgedacht. Schließlich konnte sie nicht anders als an dem zweifeln, was sie für die Vergangenheit hielt. Und sie musste an den Menschen zweifeln, die ihr nahestanden. An Vater. Aber vielleicht auch an Lindner.
Sie verbarg vor ihnen, was sie bereits wusste. So hatte sie ihnen nicht von Dorotheas Brief erzählt.
Sie trug den Brief bei sich, die ganze Zeit. Sie würde ihn auch zu Maggies Feier mitnehmen. Er steckte in einer Seitentasche des Parkas.
Ellens Finger strichen über die Aufnäher. Über die Zeichnungen, die verblassten, als würden sie in dem groben Stoff versinken.
Es tat weh. Die Vergangenheit tat weh.
Sie wusste, dass es wegen Sebastian war. Gedanken an die Vergangenheit waren Gedanken an Sebastian.
Wie es für Mama mit dem kleinen Lukas gewesen war, so war es offenbar für sie mit Sebastian. Er war ihre Wunde, die niemals heilte.
Mit der Trennung von ihm hatte sie niemals abgeschlossen. Sie hatte nur Zeit darüber gelegt. Tage und Monate und Jahre. Schicht um Schicht. Bis ein Panzer entstanden war: Hart und abweisend.
Sie hatte an Sebastian geglaubt. Sie war sicher gewesen, dass sie mit ihm auf eine besondere Weise verbunden war. Als sie bei Beckers letztem Theater-Projekt zusammen auf der Bühne standen, da mussten es alle begreifen.
Ellen dachte immer noch an ihn. Sie dachte an die gemeinsame Überzeugung von dem, was sie ändern mussten in der Welt. Daran, wie klar und gewiss ihr Weg sich zeigte, welche Freiheit dieser Weg sich nahm. An die Sehnsucht, die sie mit Sebastian fühlte und die sie damals noch nicht mit einem Wort zu fassen wagte.
Doch hatte Sebastian nicht all das verraten?
Vater hatte ihn damals zur Rede gestellt. Sebastian hatte sich zu seiner Schuld bekannt. Er hatte die Sache mit Dorothea zugegeben.
Danach hatte Ellen ihn nicht mehr gesehen. All die Jahre nicht.
Trotzdem ertappte sie sich bei dem Gedanken, sie hätte ihm die Chance geben müssen, alles zu erklären. Sie wollte nicht so empfinden. Lindner hatte das nicht verdient.
Lindner hatte seine Ecken und Kanten. Manchmal glaubte Ellen, er wolle sie zu sehr besitzen. Aber er war immer für sie da. Er war für sie da, als sie Halt brauchte.
Und er verstand sich mit Vater. Seine Eltern gingen bei von Eschrings ein und aus, seit sie sich erinnern konnte. Die Familien waren eng befreundet.
Lindner hatte oft gefragt, ob sie mit ihm zusammenziehen wollte. Sie hatte abgelehnt, weil es sich seltsam anfühlte.
In London sollte es so sein. Letzten Sommer hatten sie eine Wohnung in Kensington gemietet. Sie waren bereits während des Studiums für ein Semester dort gewesen.
Nun war es für drei oder vier Jahre. Dann würden sie gemeinsam Vaters Kanzlei in Frankfurt übernehmen. Vater wollte sich zurückziehen.
Anna klopfte an den Rahmen der offenen Tür. Sie blieb dort stehen und wartete, bis Ellen sich ihr zuwandte. Ihre weiße Schürze ließ erkennen, dass sie in der Küche arbeitete.
In der Adventszeit kam sie auch samstags, obwohl sie dazu nach ihrem Vertrag nicht verpflichtet war. Sie räumte und dekorierte und buk, bis alles zu ihrer Zufriedenheit gerichtet war. Sie hatte selbst keine Familie.
In der Rechten hielt Anna Ellens Mobiltelefon. Ein schwarzer Plastikzapfen mit knubbeligen Tasten und Stummelantenne.
„Ellen, Schatz. Ich habe hier dein Telefon. Du hast es im Windfang gelassen. Es hat geklingelt, und ich habe abgenommen. Der Rückruf von der Gärtnerei Keller.“
Ellen mochte dieses Gerät nicht. Sie verband damit Wichtigtuerei. Und die lag ihr fern.
Doch Lindner hatte sich durchgesetzt. Man müsse mit der Zeit gehen, hatte er gesagt, wenn man von der Konkurrenz nicht rechts überholt werden wolle. Nun hatten alle in der Kanzlei ein Mobiltelefon.
Ellen nahm das Telefon entgegen.
„Danke, Anna.“
Sie hatte nicht daran gezweifelt, dass Keller zurückrufen würde. Sie hatte vormittags mit einer Angestellten gesprochen. Keller war zu dieser Zeit unterwegs. Sie hatte den Rückruf verlangt, um sich bei ihm noch einmal persönlich zu beschweren.
Es war Samstagabend vor dem vierten Advent, die Geschäfte waren längst geschlossen. Keller war nirgendwo anders als zu Hause bei seiner Familie.
„Doktor von Eschring“, meldete Ellen sich. „Guten Abend, Herr Keller. Ich komme gleich zur Sache. Ich habe mir heute den Kranz angesehen, den Sie auf das Grab meiner Mutter gelegt haben. Er war so nicht vereinbart. Das haben Sie sicherlich schon mithilfe Ihres Auftragsbuchs nachvollzogen. - Sehen Sie, Herr Keller: Ich wollte Edeltanne, nicht Nordmann. Und die Kugeln goldfarben, nicht silbern. - Nein, ich nehme das so nicht an. Es macht für mich einen Unterschied. - Es ist mir gleich, wie Sie das Material besorgen. Bis morgen Mittag haben Sie das in Ordnung gebracht, Herr Keller, und wir bleiben Freunde. Verstehen wir uns? - Dankeschön. Auch Ihnen gesegnete Festtage. Guten Abend.“
Damit legte sie auf und verstaute das Mobiltelefon in ihrem Parka.
Anna setzte sich neben Ellen auf die Bank. Sie wirkte müde. Als sie bei von Eschrings anfing, war sie brünett. Nun war ihr akkurater Haarknoten fast weiß.
„Wie kannst du das bloß, Ellen? Nichts bringt dich aus der Ruhe. Und immer erreichst du, was du willst.“
Ellen fasste Annas Hand.
„Anna, du Gute. Ich erreiche, was ich will, weil ich nur mein Recht verlange.“
„Ich weiß, dass es mehr ist als das. Es ist dein Wesen. Ich weiß: Du wirst dein Leben meistern.“
„Du klingst, als würden wir uns Lebewohl sagen.“
Anna hatte Tränen in den Augen.
„Ach, Ellen.“
Ellen umarmte sie und hielt sie eine Weile.
„Ich dumme alte Gans“, sagte Anna dann, indem sie sich aus Ellens Armen löste.
Sie wischte sich mit den Händen die Tränen aus dem Gesicht.
„Lass dich doch einmal anschauen, Ellen, Schatz.“
Annas Blick blieb bei dem Haartuch.
„Ach, Ellen. Du siehst aus … wie früher.“
„Das ist der Sinn. Es ist das Motto von Maggies Feier: Zurück in die Achtziger.“
„Zurück in die Achtziger. Ein Klassentreffen … Doch es ist, als wärst du …“
Anna beendete den Satz nicht. Ihre Rechte strich zärtlich über Ellens Wange.
„Ich weiß: Du wirst ein gutes Leben haben.“
Sie stand auf und ging. Doch nur Augenblicke später kam sie zurück.
„Ellen, Schatz, ich sehe gerade, dass Doktor Lindner in die Zufahrt einbiegt. Kommst du?“
Ellen rührte sich nicht.
„Danke, Anna. Bitte lass ihn herein. Er kennt den Weg.“
Anna blieb einen Moment im Türrahmen. Dann tat sie, worum Ellen sie gebeten hatte.
Ellen hörte die Türklingel. Sie hörte, wie Anna die Tür öffnete.
Da war Lindners Lachen. Kurz darauf kamen seine Schritte die Treppe herauf. Unverkennbar: Laut, fest, energisch.
Plötzlich stand er neben ihr.
„Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg eben zum Propheten kommen. Ich grüße dich.“
Lindner beugte sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Wange.
In der Kanzlei trug Lindner grundsätzlich einen Anzug. Doch auch in der Freizeit legte er Wert auf seine Kleidung.
Er schätzte Tweed-Saccos und Cordhosen und Pullover in Erdfarben. Krawatten und Einstecktücher mit englischen Mustern. Mäntel und Schals und Handschuhe und Budapester. Seine Brille war von Armani, die Armbanduhr eine Omega, und er trug einen Onyx-Ring.
Schon als Schüler hatte er ein Jackett mit Einstecktuch getragen. In seiner Klasse hatte man ihn deshalb belächelt und ‚Dietrich Yuppie‘ genannt. Allerdings nur hinter seinem Rücken, weil man ihn seiner scharfen Zunge wegen fürchtete.
Ellen prüfte, ob die Taschen des Parkas geschlossen waren.
„Hallo, Dietrich“, sagte sie, ohne die spitze Bemerkung zu beachten.
Lindner trat einen Schritt zurück, als er den Parka bemerkte. Sein Blick fiel auf das Tuch in ihren Haaren. Einen Moment schien es Ellen, als sei er erschrocken.
„Mein liebes Kind.“ Lindner nannte sie seit Jahren so, obwohl er wusste, dass sie es nicht mochte. „Was hast du vor? Was soll dieser Aufzug? Wir wollten doch nicht mitmachen bei diesen Kindereien.“
An Lindner war keine Spur Achtziger. Er trug das unvermeidliche braune Tweed-Sacco mit Einstecktuch und darunter Hemd und Pullover.
„Mein Lieber, es ist nicht das, was wir beide wollten. Es ist das, was du wolltest. – Und nenn mich nicht so.“
Lindner räusperte sich und ergriff mit der Linken das Revers seines Jacketts. Das tat er gern, wenn er sich konzentrieren musste.
„Ich wusste nicht, dass du diese scheußliche Jacke noch hast. Ich bin davon ausgegangen, dass sie längst in der Altkleider-Sammlung ist.“
„Ich wusste ebenfalls nicht, dass ich sie noch habe. Ich habe sie beim Packen gefunden. Ist das nicht nett?“
Ellen hob den Parka und betrachtete ihn von allen Seiten.
„Willst du jetzt etwa wieder in den Straßenkampf? Ich dachte, das hätten wir hinter uns.“
„Du, und wenn? – Schon möglich.“
Lindner warf die Lippen auf.
„Du hast doch nur demonstriert, um deinem Vater eins auszuwischen.“
„Meint wer? Vater? Du warst damals doch auch dabei. Aber du hast es wohl nicht wirklich verstanden. Ich jedenfalls habe meine Werte vertreten.“
„Du hast um Werte gestritten, die für Menschen am Ende der Welt Bedeutung hatten. Die für dich selbst unerheblich waren. Und die im Übrigen völlig unrealistisch sind.“
Ellen glaubte, die alte Flamme zu spüren, tief in ihrem Inneren, verschüttet unter den Jahren.
„Das siehst du falsch, mein lieber Dietrich. Diese Fragen betreffen uns alle. Unmittelbar. Mit welchem Recht leben wir im Luxus, solange irgendwo auf der Welt Menschen verhungern?“
Lindner lachte.
„Ach, so pathetisch! Lass dir etwas sagen: Deine Ideale sind Träumereien.“
„Mag sein. Mag sein, dass das Ideal unerreichbar ist. Doch das darf uns nicht davon abhalten, uns dafür einzusetzen.“
„Na, dann will ich dich doch in die Wirklichkeit zurückholen, Ellen. Schau dich um, sieh dir an, wie du lebst! Das alles bezahlt sich nicht mit Träumereien. Durch Träumereien hast du nicht mehr Geld auf dem Bankkonto.“
„Unsere Werte waren die richtigen“, entgegnete Ellen. „Nur haben wir ihnen nicht genügt. Nur habe ich … Ich habe ihnen nicht genügt. Also hast du wohl recht: Das Hemd ist mir näher als die Jacke.“
Wiederum lachte Lindner.
„Asche auf dein Haupt, mein liebes Kind, Asche auf dein Haupt!“
„Wir hatten die Wiedervereinigung. Die Montags-Demonstrationen waren eine Bewegung, die wirklich etwas gebracht hat. Auch wenn wir nicht allzu viel aus dieser Chance gemacht haben. Wir hätten völlig neu starten können, doch haben wir weiter gemacht wie bisher. In den Anliegen, die wir damals vertreten haben, hat sich in unserem eigenen Land nichts getan. Deutschland ist nicht sozial. Deutschland ist nicht tolerant. Deutschland ist nicht friedlich.“
„Wenn du so von unserem Land sprichst, entferne doch bitte die Flaggen von deiner Jacke.“
„Die Flaggen gehören dorthin. Sie gehören genau dorthin. Wir wollten unser Land mitgestalten …“
Lindner zuckte die Achseln.
„Ja, wie kommen wir bloß auf diese Themen.“
Sein Blick streifte über die Umzugskisten.
„Ich bin froh, wenn wir in London sind. Wenn du endlich hier heraus bist. Hier spuken noch die alten Gespenster. Das ist nicht gut für dich.“
„Welche Gespenster? Was meinst du?“
Lindner ließ einige Sekunden verstreichen, ehe er etwas sagte. Das tat er, selbst wenn es nur um einfache Fragen ging. Es war eine Eigenart, die Ellen missfiel.
„Also ernsthaft jetzt: Du ziehst diese Jacke doch nicht wirklich an“, sagte er dann, ohne auf Ellens Frage zu antworten. „Und dieses Tuch auf deinen Haaren. Das willst du doch nicht wirklich.“
„Aber ja, das will ich. Und das werde ich.“
Lindner wurde laut. „Jetzt habe ich aber genug. Was soll die Verkleidung? Lass dir sagen: Du bist kein Teenie mehr. Du machst dich ja lächerlich.“
„Warum so aggressiv?“
„Ich bin nicht aggressiv. Ich hole dich nur auf den Boden der Tatsachen zurück.“
„Danke, ich bin gerade angekommen.“
Es entstand ein Schweigen.
„Zurück in die Achtziger also“, sagte Lindner, indem er die Hand ans Revers legte. „Ich hätte Maggie gar nicht zugetraut, dass sie so etwas auf die Beine stellt. Sie war doch immer nur ein unentschlossener Körper, der einen entschlossenen Kopf brauchte.“
Was Lindner sagte, klang hässlich. Aber es war etwas Wahres daran.
„Jedenfalls“, sagte Ellen, „war Maggie die Einzige, die Doro damals die Treue gehalten hat. Trotz allem.“
„Es kann mir ja egal sein. Aber versuchst du etwa, Verständnis für Dorothea aufzubringen? – Hast du eigentlich einmal etwas von ihr gehört?“
Lindner sprach im Plauderton. Doch Ellens Gefühl läutete Alarm.
Ihre Hand strich unwillkürlich über die Tasche des Parkas, in der sie Dorotheas Brief wusste. Das Papier knisterte leise.
„Wie kommst du darauf?“
Lindner ließ einige Sekunden verstreichen.
„Das Stichwort kam von dir. Du hast von der Vergangenheit gesprochen. Ich habe den Eindruck, im Moment denken einige Leute zu viel an die Vergangenheit. – Apropos: Ich habe gehört, Sebastian Gerwig lebt in Afrika.“
„Das habe ich auch gehört.“
„Und ich habe gehört“, sagte Lindner gedehnt, „er lebt dort mit einer Negerin und hat ein Kind mit ihr. Offenbar hat er zu lange mit Mo herumgehangen. Er hat wohl eine Vorliebe für schwarze Haut entwickelt.“
Lindners Worte verschlugen Ellen den Atem. So kannte sie ihn nicht.
„Das ist … rassistisch. Bist du absichtlich so?“
„Wie willst denn du sowas bezeichnen?“
„Müssen wir überhaupt unterschiedliche Begriffe für Schwarz und Weiß verwenden?“
„Sei nicht kindisch.“
„Ich glaube, wir brauchen eine völlig neue Sprache.“
„Neue Sprache, ja“, sagte Lindner beiläufig. „Sei‘s drum. Wollen wir nun los? Bringen wir es hinter uns.“
„Du armer Mensch.“
Ellen stand auf und zog den Parka an. Er schien ihr größer als früher.
Ihr Blick verweilte einen Moment auf dem Bett und den leeren Regalen. Dem Sprossenfenster, das sich dunkel zum Garten öffnete. Dann ging sie über die Galerie in ihr Arbeitszimmer.
„Ich werde Burg Senior den überarbeiteten Vertragsentwurf für die Fusion Schenker-Borsig in den Kasten werfen“, sagte sie. „Ich bin durch damit. Burg wohnt in der Nähe der Goethe.“
Sie nahm einen großen Umschlag von ihrem Schreibtisch.
Lindner blieb im Türrahmen.
„Warum lässt du den Entwurf nicht von einem der angestellten Anwälte durchsehen? Dafür sind sie da.“
„Borsig lässt sich nicht ohne Grund von Burg Senior vertreten. Burg ist ein Fuchs. Ich kreuze lieber selbst die Klingen mit ihm.“
„Was ist mit der steuerrechtlichen Seite?“
„Ist mit unserem Steuerberater abgestimmt. Und danke; aber ich brauche keine Nachhilfe von dir. Ich beherrsche mein Handwerk.“
Lindner zuckte die Achseln.
„Wir müssen auf dem Weg noch Gerald und Viktoria abholen.“
Sie stiegen die Treppen hinab.
„Von hier bis zur Goethe sind es gerade einmal 500 Meter.“
„Und?“
„Warum müssen wir überhaupt mit dem Auto fahren?“
„Kommst du jetzt mit der Klima-Sache?“
„500 Meter mit zwei Zwischenstopps. Das erscheint mir nicht sinnvoll.“
„Sieh mal aus dem Fenster. Heute gibt es noch ein Unwetter. Da laufe ich keinen Schritt zu viel.“
Anna kam aus der Küche.
„Ich wünsche euch einen schönen Abend“, sagte sie. „Habt Spaß.“
„Wird schon“, brummte Lindner.
Er klimperte in der Hosentasche mit den Schlüsseln seines Mercedes.
„Ich danke dir, Anna“, sagte Ellen und küsste sie auf die Wange. „Nun geh aber doch nach Hause. Es ist spät.“
„Ich warte noch auf deinen Vater.“
„Denkst du am Montag daran, das Roastbeef abzuholen? Ich habe es bestellt.“
„Wie jedes Jahr, Ellen, Schatz.“
„Gesegneten Sonntag, Anna.“
Ellen und Lindner schlüpften durch den Windfang hinaus. In der Zufahrt kam ihnen der alte von Eschring entgegen.
Von Eschring war hager und knochig, und seine Haut war blass wie Eis. Er hatte die Augen eines Greifvogels.
„Ellen“, sagte er mit schnarrender Stimme. „Dietrich.“
Seine Vogelaugen wanderten zwischen ihnen hin und her. Der Gruß nur mit dem Vornamen war eine Eigenart von ihm.
„Heinrich“, sagte Lindner fast ebenso schnarrend.
„Hallo, Vater“, sagte Ellen. „Du warst heute lange im Büro.“
„Die Arbeit tut sich nicht von allein“, sagte von Eschring. „Da wir beim Thema sind: Was macht der Vertrag Schenker-Borsig?“
Ellen winkte mit dem Umschlag, den sie in der Hand hielt.
„Unsere Auffassung ist eingearbeitet. Jetzt lege ich ihn Burg Senior unter den Weihnachtsbaum.“
„Gutes Kind“, sagte von Eschring.
Ein Lächeln spielte über sein kantiges Gesicht. Er fasste den Griff seiner Aktentasche fester.
„Du hast dir den Namen, den sie dir gegeben haben, redlich verdient. – Weißt du, wie sie dich nennen? Meine Büroleiterin hat es mir verraten.“
„Ich will es nicht wissen, Vater“, entgegnete Ellen. „Es war ohnehin nicht recht, dass die Klemmer es dir verraten hat.“
„Titania, mein liebes Kind. Sie nennen dich Titania.“
Ellen spürte einen Stich.
„Was für ein Unsinn.“
„Sie sagen, niemand will dich zur Gegnerin haben. Ha, das kann ich gut verstehen! Ich würde das auch nicht wollen.“
„Nun übertreib nicht so.“
„Ich übertreibe nicht.“
„Anna hat dir etwas zu essen vorbereitet. Sie ist noch hier. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Vater.“
Mit diesen Worten stieg Ellen in Lindners Mercedes.
„Ebenso, mein liebes Kind, ebenso“, sagte von Eschring.
Und zu Lindner gewandt, mit einem Nicken: „Dietrich.“
Dann wandte er sich um und ging den Kiesweg zu der Villa hinauf.
Impressum Datenschutzerklärung
© Urheberrecht. Alle Rechte vorbehalten.